Eine der Aufgaben des Adenosins besteht darin, das Gehirn vor „Überanstrengung“ zu schützen. Es setzt sich an bestimmte Rezeptoren auf den Nervenbahnen. Ist Adenosin angedockt, ist das ein Signal für die Zelle, etwas weniger zu arbeiten. Das ist ein Rückkopplungseffekt: Je aktiver die Nervenzellen, desto mehr Adenosin wird gebildet und desto mehr Rezeptoren werden besetzt. Die Nervenzellen arbeiten langsamer und das Gehirn ist vor „Überanstrengung“ geschützt. Das Koffein ist dem Adenosin in seiner chemischen Struktur ähnlich und besetzt dieselben Rezeptoren. Adenosin kann nicht mehr andocken, und die Nervenbahnen bekommen kein Signal – deshalb arbeiten sie einfach weiter. Bei höheren Dosen verhindert Koffein den enzymatischen Abbau von cAMP (cyclischem Adenosin 3’,5’ monophosphat). Dieses spielt im menschlichen Organismus als second Messenger eine wichtige Rolle bei der Hormonregulierung des Zellstoffwechsels. Koffein hemmt jene Enzyme, spezifische Phosphodiesterasen, die für den Abbau von cyclischem zu acyclischem AMP verantwortlich sind. So kommt es durch den gehemmten Abbau zu einem Anstieg von cAMP in den Zellen. Wenn Koffein den Abbau von cAMP einschränkt, hält die von cAMP verursachte Adrenalinausschüttung länger an. Koffein verhindert die beruhigende Wirkung des Adenosin und verlängert die Dauer der Adrenalinwirkung. Somit treten die oben beschriebenen Auswirkungen ein.
Wenn ein Mensch über längere Zeit hohe Dosen von Koffein zu sich nimmt, verändern sich die Nervenzellen. Sie reagieren auf das fehlende Adenosin-Signal und bilden mehr Rezeptoren aus. Jetzt können die Adenosin Moleküle wieder an den Rezeptoren gebunden werden. Die Nervenzellen arbeiten langsamer. Die anregende Wirkung des Koffeins ist also stark eingeschränkt. Man nennt dieses Phänomen „Toleranz“. Bereits nach 6-15 Tagen starken Koffeinkonsums entwickelt sich eine derartige Toleranz. Wird der Koffeinkonsum stark verringert, können Entzugserscheinungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit usw. auftreten. Meistens sind diese Symptome aber nur von kurzer Dauer. Die wissenschaftliche Literatur ist sich nicht darüber einig, ob Koffein wirklich ein Suchtmittel ist. Einerseits hat es einige Gemeinsamkeiten mit typischen Suchtmitteln, andererseits ist sein Suchtpotential so minimal, dass man es nicht als Suchtdroge bezeichnen kann. Die wichtigsten Eigenschaften, die Koffein mit anderen Suchtstoffen gemeinsam hat, sind Entwicklung von Toleranz, psychische und körperliche Abhängigkeit mit Entzugserscheinungen. Toleranz tritt bei nicht unbedingt übermäßigem, aber regelmäßigem Koffeingenuss auf.


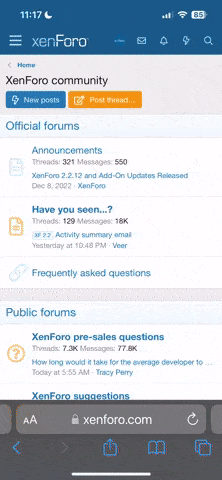
 )
)

 ausgerechnet da war dann werbung und kommts danach nochmal angucken
ausgerechnet da war dann werbung und kommts danach nochmal angucken 

