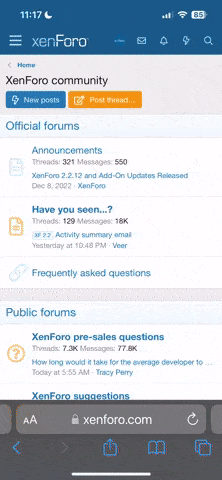hmm, ich seh das anders. ein gehäuse, abgesehen von diversen löchern und schlitzen für schrauben usw, ist ein geschlossener kasten mit lüfter-, karten-, mainboard-, und laufwerks-öffnungen die im ungenutzten fall aber meist verschlossen sind.
einzige ausnahme, der hintere lüfterplatz wo meist ein ausblasender lüfter montiert ist
also grob gesagt, ein geschlossener kasten mit einem loch(zwei wenn es noch einen einblasenden frontlüfter gibt).
Natürlich hat die Gestaltung des Gehäuses einen gewissen Einfluss auf dessen Strömungswiderstand, da sind wir uns schon einig. Allerdings überschätzt du den Einfluss meiner Ansicht nach deutlich. Hinzu kommt, dass heute bei der Mehrheit aller Gehäuse die Rückseiten recht durchlässig gestaltet werden (teilweise auch die Seitenteile). Die Zeiten der geschlossenen Stahlkästen in denen nur die nötigsten Öffnungen gestanzt waren sind schon lange vorbei. Außerdem stellt je nach Bauart auch das Netzteil, sofern des nicht im Nebenstrom betrieben wird, sondern mit Innenluft gekühlt wird, einen weiteren aktiven Auslass dar. Gehäuse die bis auf einen Lüfterplatz am Heck geschlossen sind, sind heut zu Tage jedenfalls relativ selten.
Aber ganz unabhängig davon ist das wie gesagt nicht der ausschlaggebende Punkt der den Luftdurchsatz maßgeblich bestimmt, da das Gehäuse im Vergleich zu einem internen Radiator (unabhängig von dessen Einbauort) einen relativ kleinen Luftwiderstand darstellt. Nur wenn man die Abluft wirklich in ein nahezu vollständig geschlossenes Gehäuse blasen würde, ist deine Argumentation in gewissen Maße verständlich, aber dass das keine gute Idee ist, sollte eigentlich klar sein und in so einem Gehäuse könnten am Heck auch keine Lüfter montiert werden, denn dafür sind nun mal Auslassöffnungen mit entsprechenden Querschnitten nötig. Dass es ebenfalls wenig Sinn hat so etwas dann mit einem turbinenartig arbeitenden Gebläse ausgleichen zu wollen, dürfte auch jedem Einleuchten.
Im Endeffekt reduziert ein Radiator mit - sagen wir - drei 120er Lüftern auf Wakü-gängiger Drehzahl den Gesamtluftdurchsatz locker auf den Durchsatz den ein frei arbeitender Lüfter bei gleicher Drehzahl erzeugt. Je nach Radiator auch deutlich stärker. Der Strömungwiderstand den das Gehäuse zusätzlich bietet ist dagegen schon durch eine einzige Lüfteröffnung im Heck oder durch ein mit Innenluft gekühltes Netzteil nahezu völlig vernachlässigbar. Es geht bei Gehäuselüftern also im Wesentlichen nicht darum den Luftstrom zu unterstützen, sondern darum ihn zu lenken.
um diesen wenn darin wärme entsteht kühl zu halten, muss kühlere luft rein und raus, sonst hitzt sich die luft darin immer weiter auf.
Die Luft kommt immer heraus - die Frage ist nur wo sie abströmt. Bei ungünstiger Platzierung der größten Öffnungen passiert das an Stellen, die nur wenig bei der Kühlung der nicht unter per Wakü versorgen Komponenten helfen und es können sich u. U. an ungünstigen Stellen warme Totluftzonen bilden. Letzteres gilt es natürlich zu verhindern. Aber nicht vorrangig um die Radiatorlüfter zu unterstützen, sondern eben um dafür zu sorgen, dass an die richtigen Stellen Strömung herrscht, die die Abwärme der darin liegenden passiven Komponenten mitnehmen kann.
hat mann nur einen einblasenden lüfter in diesem geschlossenen kasten mit loch hinten(wenn da kein lüfter sitzt)kommt ca soviel luft raus(hinten) wie der lüfter, gegen den luftwiderstand des gehäuses hinein drücken kann.
Es kommt nicht nur circa so viel hinten raus wie vorne rein geht, sondern exakt!

. Ansonsten wäre die Kontinuitätsgleichung verletzt und das Gehäuse würde wie gesagt aufgeblasen oder implodieren. Du überschätzt den Luftwiederstand eines Gehäuses wie gesagt deutlich, sofern es Luftauslässe hat. Selbst wenn Letztere eher klein sind, stellen sie im Regelfall immer noch erheblich weniger Widerstand dar als ein Radiator und tragen damit auch nur geringfügig zum Gesamtwiderstand bei. Bereits eine einzige offene Lüfteröffnung ohne Lüfter reduziert den Strömungswiderstand meiner Erfahrung nach bereits so gewaltig, dass der Strömungswiderstand eines Gehäuses bei wakü-üblichen Luftdurchsätzen vernachlässigbar gering ist. Die Frage ist dann nur, ob die Öffnung günstig platziert ist. Auch zu viele Öffnungen können btw problematisch sein, weil die Luft so zwar noch ungehinderter abströmt, aber eben durch so große Querschnitte, dass die Strömungsgeschwindigkeit im Gehäuse sehr gering werden kann, so dass die Wärme von passiv zu kühlenden Komponeten nur noch schlecht abgeführt wird, selbst wenn sie in der Luftströmung liegen. Auch in dem Fall kann man mit aktiven ausblasenden Lüftern steuernd einwirken

. Der Gesamtdurchsatz ist aber auch dann nicht der Knackpunkt.
wird der vordere lüfter nun durch einen hinteren unterstützt erhöht sich der durchsatz mit sicherheit, wobei ich annahme das es im idealfall(praktisch aber weniger wegen laufwerkskäfigen, lüfterfiltern, staubfiltern, usw) das soviel luft raus kann, wie der lüfter mit dem wenigsten durchsatz schafft, plus einem teil von der luftmenge, die der lüfter mit dem höheren durchsatz mehr an durchsatz schafft -frei geschätzte 20% von der differenz der beiden luftmengen.
Nochmal - es kommt wie gesagt stets exakt so viel Luft raus wie rein kommt, völlig unabhängig davon ob weitere Lüfter verbaut sind oder nicht. Wenn man am Auslass viele oder hochdrehende Lüfter verbaut und am Radiator nicht so viel aktiv hinein gefördert wird, wirkt das theoretisch wie ein PushPull-Sandwich, aber angesichts dessen, dass das Gehäuse eben realistischer Weise nicht an jeder Stelle außer dem Lufteinlass, hinter dem die Radiatorlüfter sitzen, und an den Lüfterplätzen die die Luft wieder hinaus befördern luftdicht ist, stammt je nach Widerstandverhältnis zwischen Radiator und diesen Lücken eben ein mehr oder weniger großer Teil der Luft aus Nebenströmen, was den ohnehin schon geringen Effekt von PushPull-Konfigurationen weiter minimiert. Solche Gehäuse gibt´s aber nicht. Baut man viele Auslasslüfter ein fördert man außerdem auch die Ansaugung von Staub in jeder Ritze.
ein 'irgendwo wird die luft schon raus oder rein gehen' halte ich für ilusionorisch und zu risikobehaftet um mich darauf für die kühlung eines PC's zu verlassen, dann rechne ich lieber 'ungenau' mit rein- und rausblasendem luftdurchsatz.
Sowohl Praxis als auch Theorie zeigen etwas anderes

. Auch ohne ausblasende Lüfter ist die Kühlung der passiven Komponenten in keiner Weise gefährdet, sofern man dafür sorgt, dass die Luft an den richtigen Stellen heraus strömen kann. Mit Auslasslüftern kannst du den Luftstrom aktiv richtungsmäßig steuern, wenn passiv keine Möglichkeit besteht für einen Durchströmung kritischer Bereiche zu sorgen, weil z. B. kein Platz für große Öffnungen vorhanden ist, oder weil man nicht basteln möchte. Die Luft sucht ohne Lüfter ihren Weg immer exakt proportional zum Strömungswiderstand und tritt somit megenmäßig vor allem dort aus wo der offene Querschnitt am größten ist. Auf den Gesamtdurchsatz hat das aber wie gesagt extrem wenig Einfluss, weil z. B.schon eine einzige offene Lüfteröffnung extrem wenig Strömungswiderstand erzeugt, so dass auch große Luftmengen nahezu ungehindert abströmen können. Besonders im Vergleich mit einem Radiator ist das einfach kein Faktor.
du sprachst vom radiator als grösstem luftwiderstand, da gehe ich mit dir konform, aber was ist das ganze für sich denn gesehen im übertragenen sinne?
eben, ein luftwiderstand, genau wie ein geschlossenes gehäuse nur mit luftschlitzen und schrauben-löchern

und dann sind wird bei der situation von der ich eben sprach.
also ist es doch wichtig ein- und ausblasende luftmengen zu kennen und nicht davon aus zu gehen das die luft schon 'irgendwo' raus käme.
Sie strömt nicht irgendwo hinaus, sondern wie gesagt proportional zum Strömungwiderstand überall wo sie kann (in schmalen Ritzen strömt meist nichts weil der Druckunterschied zwischen innen und außen so winzig ist, dass die Luftreibung nicht überwunden wird). Dein Szenario wäre nur für den Fall relevant, dass du den Radiator wirklich in eine nahezu vollständig geschlossenen Kiste setzt, die einen ähnlich großen oder größeren Strömungswiderstand verursacht als der Radiator selbst. So ein Gehäuse dürfte dann aber keine Installationsmöglichkeit für Lüfter haben oder müsste dort mit sehr engmaschigen Gittern versehen sein, die den Widerstand stark erhöhen. Schon ein einziger offener Luftauslass mit einem großen Querschnitt, wie z.B die Öffnung für einen Hecklüfter, lässt den Strömungswiderstand eines Gehäuses im Vergleich zum Luftwiderstand eines Radiators fast verschwinden.
wenn ich mit einem 360er-radiatoren, also 3 120er lüftern, luft in den pc drücke, muss dieses luftvolumen auch wieder raus können, sonst erhöhe ich unnütz den luftwiderstand des gehäuses und verringere den luft-durchsatz, wie ein push-pull-radiator wo man die pull-lüfter abschaltet.....
Dein Vergleich mit dem PushPull-Radiator ist nur theoretischer Natur. Praktisch ist das ist aus o. g. Gründen schlicht und einfach nicht der Fall. Wenn du den Luftdurchsatz dieser beiden Konfigurationen in einem realen Setup misst, kommst du zum gleichen Ergebnis - der Effekt ist einfach zu gering. Würde man mit Gehäuselüftern am Auslass eine Push-Pull Konfiguration erreichen wollen, die am Radiator für messbar höheren Durchsatz sorgt, müsste das restliche Gehäuse vollkommen luftdicht versiegelt sein. Das ist nicht realistisch.
nimm mal einen karton, setze einen lüfter ein und messe wieviel luft der da reindrücken kann.
dann mache ein loch in den karton, gross genug für einen zweiten lüfter und messe wieder.
danach nehme einen zweiten, ausblasenden lüfter, und betrachte wieder was du misst, du hast ja ein messgerät dafür.
vieleicht ergibt sich ja mehr als wir beide jetzt beachten, weil sich die luftmengen der lüfter zu einem gewissen teil addieren? vorstellbar währe es

Du wirst lachen, aber das habe ich bereits in etwas aufwändigeren Art und Weise getan. Sonst könnte ich hier auch nicht so bestimmt argumentieren. Hab nämlich einen kleinen
Prüfstandsaufbau gebaut (zumindest mal den Grundaufbau), mit dem einerseits der Luftdurchsatz und anderseits auch die Lautstärke von Lüftern in einen schallgedämmtem Messkammer geprüft werden sollte. Das Projekt ist aber bis heute nicht viel weiter gediehen als in der verlinkten Bildergalerie zu sehen. Hab lediglich mal paar provisorische Adapterplatten zum Einhängen von Lüftern gemacht, aber die endgültigen Teile stehen noch auf meiner ToDo Liste für die CNC-Fräse (jedoch sehr weit hinten). Jedenfalls hatte ich das Anemometer und das Schallpegelmessgerät für diesen Prüfstand angeschafft

. Nur um mal ne Sonde in einen PC halten zu können wäre das ein bisschen heftig gewesen. Konnte die Geräte auch schon beruflich ab und zu einsetzen.
Trotz fehlender Mikrofone für die Spektrumanalyse und unvollständiger Schalldämmkulisse im unteren Teil, habe ich es mir jedenfalls nicht nehmen lassen schon mal ein paar einfache Versuche zum Luftdurchsatz zu machen - letztendlich genau um den erwartbaren Einwand zur Testmethodik zu überprüfen, den du hier zu argumentieren versuchst. Diese Gedankengänge habe ich daher auch alle schon mal durchexerziert, aber weder in der Praxis noch wenn man es überschlägig rechnet kommt man zu anderen Ergebnissen als den oben geschilderten. Ausblasende Lüfter sind ein einfach nicht relevant für den Gesamtdurchsatz. Der Versuch im fliegenden Aufbau zeigte jedenfalls, dass eine messbare Durchsatzerhöhung bei Lüfterdoppelbestückung mit einem Lüfter unten in der Messebene und einem oben auf dem Loch im Deckel nicht in einer Größenordnung vorhanden war die im Rahmen der Messgenauigkeit sicher zu bestimmen gewesen wäre. Einschränkend muss ich dazu sagen, dass der Versuch natürlich nicht dem letztendlichen Messaufbau entsprach. Das war nur ein fliegender Testaufbau bei dem ich die Messsonde von Hand etwa 15cm über dem unteren Lüfter gehalten habe. Der Test sollte lediglich der Einschätzung dienen, ob der Auslassquerschnitt ausreicht und wie sich ein mutmaßlich unterstützender Auslasslüfter denn nun tatsächlich auswirkt. Zum Einsatz kamen zwei Yate Loon D12SL-12 auf 12V (also mit Nenndrehzahl 1350 Upm) deren Drehzahl jedoch bei dem Test nicht überwacht wurde.
Mag sein, dass man mit irgendwelchen triebwerksartigen Gebläsen in Bereiche käme, in denen sich vllt. ein Unterschied messen lässt, aber mit den eh schon sehr hoch drehenden Loonies konnte ich jedenfalls keinen sauber messbaren Unterschied zur Konfiguration nur mit Einlasslüfter feststellen (noch höher drehende Lüfter hab ich sowieso nicht da - ist angesichts der Lautstärke imho auch nicht für zielführend). So viel Durchsatz wie so ein hochdrehender Lüfter ohne Widerstand erzeugt, wird hinter einem 360er Radi mit drei Lüftern auf Wakü-gängigen Drehzahlen jedenfalls nicht erreicht.
Da der Prüfstand auch für akustische Messungen von Lüftern und Pumpen ausgestattet werden sollte, ist da aber noch viel Arbeit nötig, um das mal zum Ende zu bringen. Momentan hat das Projekt bei mir jedoch keine hohe Priorität mehr. Meine Interessenslage hat sich zwischenzeitlich etwas verschoben und ehrlich gesagt, ist der Aufwand den Prüfstand so universell wie möglich zu gestalten größer als ursprünglich gedacht

...