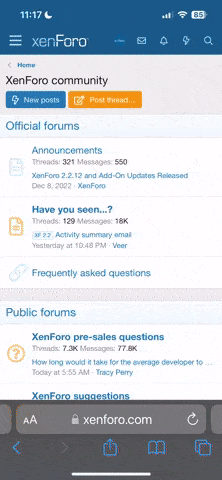Würden Genießer, die weltläufig über die diskrete Marzipannase und die komplexe mineralische Struktur eines Cuvées parlieren, sich der Anbaupraxis zuwenden, so stünden ihnen mancherlei Überraschungen bevor. Zum Beispiel ahnt kaum einer von ihnen, worauf viele der edlen Rebstöcke wurzeln: auf Müll.
Vor 30 Jahren waren Weinfunktionäre auf die Idee gekommen, den unsortierten, kleingeschredderten Inhalt Pariser Abfalleimer die Marne herunterzuschippern und auf den Weinbergen abzuladen. Anfangs mögen hauptstädtische Kartoffelschalen und Apfelgriebse als Dünger noch eine Bereicherung gewesen sein, aber im Laufe der Jahre tauchten immer mehr zerkleinerte Plastiktüten und Joghurtbecher, später auch Batterien, Medikamente und Spritzen auf den Weinbergen auf.
Seit drei Jahren ist diese Form des Müllversands zwar verboten. Doch Tausende von Müllsackschnipseln, die den Boden mancherorts von weitem leicht blau getönt erscheinen lassen, führen jedem Besucher anschaulich vor Augen, dass Plastik nicht verrottet. Weil Touristen von dem Anblick geschockt sind, überdecken einige der Winzer den Unrat neuerdings unter gehäckselter Baumrinde.
»Und dabei ist das, was man sieht, noch das Geringste«, klagt Selosse. »Die Chemie hat keine Farbe. Da draußen stehen 20, 30 Jahre alte Weinstöcke. Die Hänge sind zum Teil voll gepumpt mit den Giften mehrerer Generationen.« Vielleicht, überlegt Selosse und zerreibt bedächtig eine Handvoll feuchten Boden zwischen den erdgeschwärzten Fingern, waren Mission und Katana der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.