Im Grundgesetz ist die Trennung von Staat und Kirche festglegt; sie wird in das GG aus Art. 137 Abs. 1 der Weimarer Reichsverfassung übernommen: „Es besteht keine Staatskirche.“ Die Bestimmung hatte in der Umbruchsituation bei der Verfassungsgebung 1919 v.a. die Aufgabe, in den Evangelischen Kirchen das seit der Reformationszeit etablierte so genannte landesherrliche Kirchenregiment der Kirchen mit dem Landesherrn als höchstem Bischof (summus episcopus, daher auch die Bezeichnung dieses Systems als „Summepiskopat“) zu beenden. So erklärt sich auch die Formulierung, der ein Gebot der Trennung von Staat und Kirche nicht unmittelbar zu entnehmen ist. Die Interpretation geht aber von der historischen Bedeutung aus und erklärt eine institutionelle Verflechtung von Staat und Kirche, eine Identifikation des einen mit der anderen, für unzulässig. Fraglich ist aber, wie einschneidend diese Trennung sein muss. Es handelt sich dabei um die umstrittene Frage nach der Reichweite des Trennungsgebots.
Nach einer Ansicht handelt es sich um eine „Trennung in der Wurzel“: Staat und Kirchen dürfen sich grundsätzlich gar nicht innerhalb einer Institution treffen, sofern eine Kooperation nicht ausdrücklich vom GG zugelassen ist (wie etwa beim Religionsunterricht durch Art. 7 Abs. 3 GG). Danach erscheint der Religionsunterricht als Ausnahme eines für die Staatsorganisation grundlegenden Prinzips.
Nach der anderen Auffassung ist eine solche strikte, laizistische Trennung dem GG nicht zu entnehmen. Der Staat muss nicht jegliche religiöse Betätigung in seinen Institutionen unterbinden. Vielmehr ermöglicht er seinen Bürgern durch die Zulassung religiöser Betätigung, von ihrer religiösen Freiheit auch im staatlichen Raum Gebrauch zu machen. Auf den Religionsunterricht angewendet heißt das: Wenn der Staat Schüler der Pflicht unterwirft, seine Schulen zu besuchen und sich von ihm bilden und ausbilden zu lassen, dann ermöglicht er ihnen durch das Angebot eines Religionsunterricht auch, die nach ihrer persönlichen religiös-weltanschaulichen Orientierung möglicherweise wichtige religiöse Komponente in ihre Bildung mit einzubeziehen. Diese Sichtweise geht von dem Recht des Kindes auf Religion aus, das auch in das Recht auf Religionsunterricht münden kann.
http://de.wikipedia.org/wiki/Religionsunterricht_in_Deutschland
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:12 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:02 ----------
hier wird einem doch vorgegeben was man glauben soll.
Es mag durchaus Schulen/Lehrer geben wo das so ist. Meist hör ich sowas eher vom katholischen Unterricht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass das bei mir in der Schulzeit nie so war ( im evang. Unterricht ). Vlt. hatte ich auch einfach nur Glück mit den Lehrern?!
Wie haben viel über Sekten gelernt, über andere Religionen, über den Atheismus, über das neue und alte Testament usw. usw., was man halt so macht.
Aber meine LehrerINNEN ( ich hatte komischerweise nie einen LehrER im Reli-Unterricht ^^ ) haben uns nie dazu bewegt an etwas glauben zu müssen oder das das Christentum das einzig wahre ist oder sonst was. Das fand ich immer sehr gut. In einer Reli-Arbeit gibts meist immer eine Frage mit " wie stehen sie dazu " und wir hatten viele Atheisten im Reli-Unterricht und dann kam halt auch ein " ich glaube NICHT daran/NICHT an Gott " oder ähnliches.
Ja, es gibt LEIDER Lehrer die von sowas voreingenommen sind und man dadurch gleich ne schlechtere Note bekommt. Aber bei meinen Lehrerinnen war das NIE der Fall, für die Leute gabs dann trotzdem eine 1 wenn sie ihre Argumente gut erklärt haben.
Auch auf kritische Fragen haben sie gut reagiert, Fehler der Kirche eingestanden usw.
Die sogenannten " Atheisten " in meiner Klasse fanden den Reli-Unterricht sehr sehr gut und hatten nie das Gefühl in eine Richtung gedrängt zu werden.
Wie gesagt, leider ist das nicht überall der Fall. Aber an meinem Beispiel sehe ich einfach kein " Problem " am Reliunterricht. Jeder hatte was davon und die meisten fanden es immer recht spannend und interessant, sogar die, die nicht gläubig waren. Es kommt halt auf den Lehrer an.


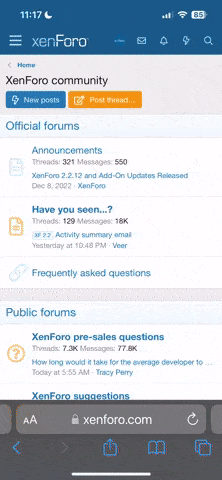




 liegt schon zu lange zurück für mein Kurzzeitgedächtnis.
liegt schon zu lange zurück für mein Kurzzeitgedächtnis.


